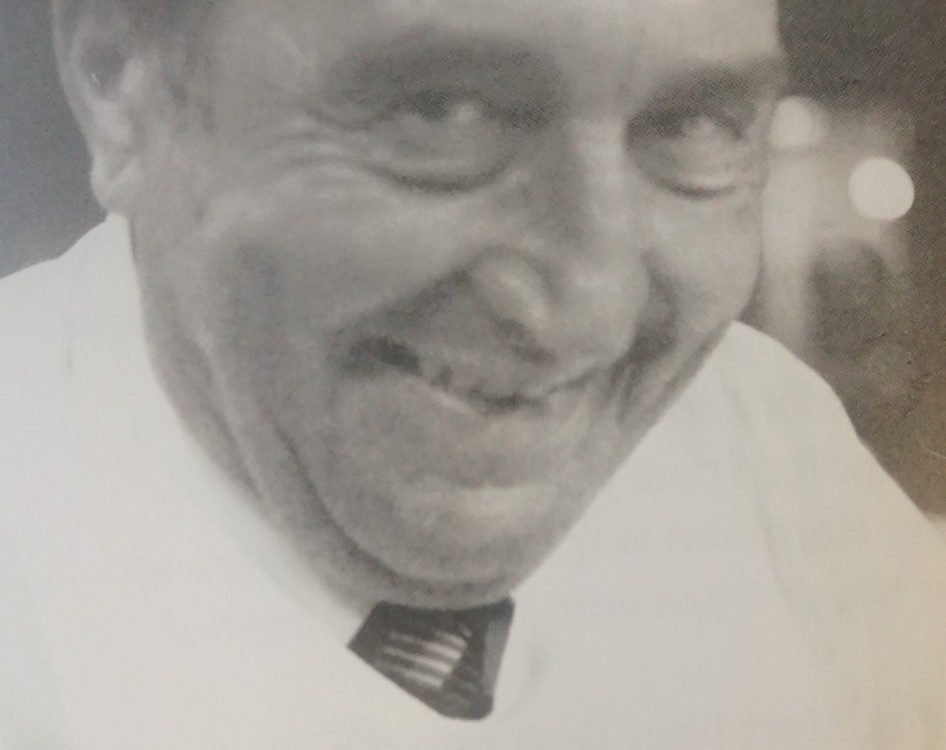Margareth Graf, verwurzelt und flexibel

Mondlicht
6. September 2022
Ein Vorbild für die Politik von heute
6. September 2022Wenn man mit der heute über Achtzigjährigen spricht, fällt einem sofort auf, wie sie einerseits sehr verwurzelt ist in all dem, was sie von frühester Kindheit gelernt hat, andererseits, wie innerlich beweglich diese Frau ist, offen für alles Neue.
Da ihr Vater Hans, der sich als armer Tagelöhner mit Schmuggeln ein kleines Zubrot verdient hatte, ins Visier der faschistischen Polizei geraten war, blieb ihm mit Mutter Burgl und den beiden Kindern – Hermann war zwei Jahre alt und die kleine Marianne gerade erst zweieinhalb Monate – nur das Auswandern. Es war das Kriegsjahr 1940. Auch den Großvater, den „Kloutzvater“, nahmen sie mit, weg vom vertrauten Moos im Passeiertal mit seinen steilen Bergen ringsum und hinaus nach Oberösterreich ins Mühlviertel. Sie mussten mit einer kleinen, feuchten Wohnung ober einer Waschküche vorliebnehmen, dankbar, dass Vater Hans schon bald ein bescheidenes Auskommen als Briefträger fand. Denn bereits im August 1941 kam die kleine Margareth zur Welt und nun waren noch mehr hungrige Mäuler zu stopfen. Die Not war groß, denn der Vater wurde jetzt zum Kriegsdienst eingezogen.
Die Russen kommen!
Während der Vater noch im Krieg in Kroatien war, kam im Oktober 1943 Hedwig, das vierte Kindlein zur Welt. Zu Margareths frühesten Kindheitserinnerungen gehört der allgegenwärtige Hunger, der sie jahrelang begleitete, sowie die vielen Umzüge von einer armseligen Behausung in die nächste. Dann hieß es nach dem Zusammenbruch im Mai 1945 plötzlich: „Die Russen kommen!“ Und wieder war die Pixner – Familie mit den vier kleinen Kindern auf der Flucht. Auf einem geliehenen Leiterwagen hatte alles Hab und Gut Platz. Einmal fanden sie in der Mansarde eines Gasthauses Unterschlupf, in einem einzigen Raum für fünf Personen. Großvater war inzwischen fern seiner geliebten Südtiroler Heimat an Heimweh gestorben. Nach weiteren Zwischenstationen ging es 1947 endgültig zurück.
Wieder daheim! Aber daheim?
Von Gurgl im Ötztal aus flüchteten die Eltern mit ihren 4 Kindern über das Königsjoch illegal nach Südtirol. Sie scheuten sich aus Angst vor einer Kontrolle jedoch, auf dem Normalweg über die Essener Hütte zu gehen, sie nahmen den weitaus gefährlicheren Schmugglersteig durch den „Kamin“, seilten die größeren Kinder an, das Jüngste kam in den Buckelkorb. Gott allein weiß, wie viele Stoßgebete die Eltern zum Himmel geschickt haben mochten, alle kamen heil und unbemerkt auf der Seeberalm und schließlich in Moos an. Aber hier gab es erst weder eine Unterkunft, noch eine Arbeitsmöglichkeit für den Vater. So mussten die Kinder bei fremden Bauern um eine schmale Kost hart arbeiten, die Familie war auseinandergerissen, von einem Daheim konnten sie nur träumen. In dieser Zeit kam noch Zuwachs, der Nachzügler Rudl. Endlich jedoch erhielt die Familie die lang erkämpfte italienische Staatsbürgerschaft, und alles wendete sich langsam zum Besseren.
Fremdes Brot schmeckt bitter
Margareth kam bereits mit elf Jahren auf den Unterprischhof hoch über Rabenstein zum Hüten. Lang und im Winter gefährlich war ihr Schulweg, so manches Mal hatte sie aus Überforderung Nasenbluten. Später, sobald sie einen Lohn erhielt, wurde ganz selbstverständlich alles daheim abgegeben – bis sie 21 Jahre alt war, so erinnert sie sich heute. Nur so war es möglich, dass sich die Eltern mit viel Verzicht, harter Arbeit und Zusammenhalt 1958 das „Waldhäusl in Lechn“, ein spätes Daheim bauen konnten. Empfand sich die ausgehungerte, bettelarme, dafür kinderreiche Familie erst auch überall nur geduldet, so kam dann doch die Zeit, da man die tüchtigen, arbeitsamen Kinder überall zu schätzen begann. Denn Genügsamkeit und Zufriedenheit, gepaart mit Redlichkeit und Fleiß, dies zeichnete alle aus, dies hatten sie von kleinauf gelernt.
Junge Liebe, junges Glück
Margareth lernte ihren Albert kennen, einen von den 14 Seehofkindern von Rabenstein. Er war von seiner Arbeitsstelle in der Schweiz über Weihnacht auf Urlaub nachhause gekommen. Eine fröhliche Rodelpartie unter Jugendlichen war angesagt, „da funkte es bereits“, wie sich Margareth noch gut erinnert. Aber sie besuchte gerade einen 6 Monate dauernden Haushaltskurs in Meran, und, obwohl Albert ihr immer wieder schrieb, plagten sie viele Zweifel. Auf einer Wallfahrt nach Riffian erhielt sie die Gewissheit: Sie wollte ihren weiteren Lebensweg mit dem ebenso fleißigen, wie feschen Albert gehen. Erst folgte sie ihm für ein Dreivierteljahr in die Schweiz, um dort zu arbeiten. „Am 1. April 1967 heirateten wir und hatten alle Wetter: Sonne, Regen, Schnee; der Traupriester meinte, es sei eben wie in einer Ehe auch! Doch dieser „Aprilscherz“ hat 54 Jahre lang gehalten“ meint Margaret und lächelt.

Margareth im Kindergarten in Oberösterreich (vorne links)
Aller Anfang ist schwer
Die Beiden hatten kaum Erspartes, hatten sie doch zeitlebens den Eltern mit ihrem Verdienst geholfen. So begannen sie ganz bescheiden, anfangs hatten sie nur Küche und Zimmer und oft eine leere Brieftasche. Sparen hatten beide von Kindesbeinen an gelernt und Albert bekam eine Arbeit als Maurer im fernen Lana. Es war ein geregelter Verdienst, doch er war von Montag bis Samstag fern von seiner Margaret. Die Freude war riesig, als 1968 das erste der drei Kinder auf die Welt kam. Doch das Wohnen blieb lange ein Provisorium: einmal durften sie bei ihren Eltern, dann wieder bei der Seehofmutter bleiben. Doch endlich, 1972, konnten sie ihr eigenes Heim beziehen. Da kam das zweite Kind zur Welt. Wann immer es ging, arbeitete Margareth, um das Gehalt ihres Mannes aufzubessern. 1981 wurde dem Paar noch ein Mädchen geschenkt. Acht lange Jahre pflegte Margaret ihre Mutter zuhause. Jahrelang arbeitete sie im Sommer als Sennerin, erst auf der Schenner-, später auf der Rempenalm. So konnte sie die Kinder bei sich behalten.
Mesnerin und Nothelferin
Für 15 Jahre hat sie gemeinsam mit ihrem Mann den Mesnerdienst übernommen. „Da war ich mit Leib und Seele dabei, das war für mich eine Berufung zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen“, so erzählt sie und ihre Augen leuchten. Aber nicht bloß das: weit über ihr Dorf hinaus ist bekannt, dass Margareth überall hilft, wo sie nur kann. Schicksalsschläge blieben der tiefgläubigen Frau nicht erspart, von Krankheiten und Operationen spricht sie nicht, doch als am 1. 3. 1921 infolge Corona ihr Albert und kurz darauf ihre beste Freundin stirbt, wird es sehr dunkel um sie. Doch Gebet, Gottvertrauen und die Liebe zur Natur helfen ihr und heute sagt sie: „Wenn mir Albert auch fehlt, ich weiß ihn bei Gott, und so ist es gut.“ Dass in ihrer Familie die gegenseitige Wertschätzung ganz großgeschrieben wird, ist ihr auch eine kostbare Hilfe. Zum Abschuss möchte sie noch etwas ihr sehr Wichtiges sagen: „In der Kriegs- und Nachkriegszeit war unser Los nichts Besonderes, vielen Optanten und Rückwanderern ging es ähnlich.“
Christl Fink