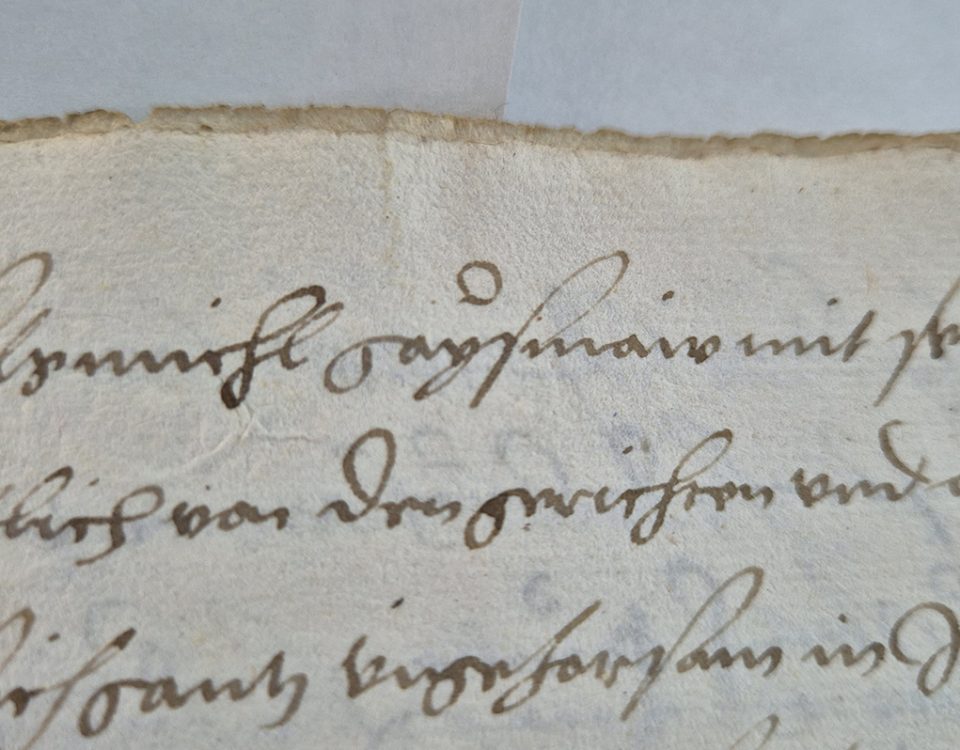Beruf(ung) Hausarzt

Seniorenheim Algund sagt Danke
2. August 2024
Gegen Kopfschmerzen und Augenleiden
5. September 2024Viele kennen Martin Gruber, den Bergdoktor der gleichnamigen ZDF-Arztserie mit Hans Sigl. Verkörpert er doch alles, was einen guten Hausarzt ausmacht: immer erreichbar, kompetent, echtes Kümmern um die eigenen Patienten und gute Vernetzung mit Experten und Kliniken. Hausarzt mit Leib und Seele war auch Peter Grüner. 35 Jahre lang – zuerst in Schnals und dann 25 Jahre in Schenna. Vor einem Jahr ist er in den Ruhestand getreten.
von Josef Prantl
Viele waren überrascht, als sich vor einem Jahr die Nachricht verbreitete, dass Peter Grüner in Pension geht. Die Entscheidung hatte er bewusst getroffen. „Hausarzt zu sein, ist mit den Jahren immer unbefriedigender geworden“, sagt er rückblickend. Nicht die Arbeit mit den Patienten ist es, die belastet, sondern das Drumherum. Arzt zu sein, den Menschen oft helfen zu können, der Kontakt zu ihnen, das hat ihm gefallen.
Vor dem Computer statt beim Patienten
Einer der Hauptgründe für die wachsende Unzufriedenheit bei vielen Hausärzten ist der ständig wachsende Bürokratieaufwand. „Ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, nicht genug Zeit mehr für meine Patienten zu haben und das löst Stress aus,“ erklärt er. Die bürokratischen Prozesse müssen im Gesundheitswesen vereinfacht und die Digitalisierung vorangetrieben werden, wenn die medizinische Versorgung nicht gefährdet werden soll, ist sich Grüner sicher. Es kann nicht sein, dass die Datenerfassung und Dokumentation von Patientendaten viele Arbeitsstunden täglich in Anspruch nehmen. Aber auch das Misstrauen der Versicherungen und Verwaltung gegenüber den Ärzten belastet zunehmend, etwa bei der Verschreibung von Medikamenten bzw. Behandlungen.
Berufswahl
Grüner ist in Schlanders geboren, besuchte dort das Realgymnasium und studierte dann Medizin in Innsbruck. Es folgten drei Jahre praktische Ausbildung als Assistenzarzt an den Abteilungen Südtiroler Krankenhäuser. „Man bekam einen sehr guten Einblick in alle Fachbereiche und damit eine fundierte Ausbildung zum Allgemeinmediziner“, erinnert er sich. Heute erfolgt die Ausbildung am Institut für Allgemeinmedizin an der Claudiana in Bozen und dauert drei Jahre. Im Unterschied zu Deutschland, wo es den „Facharzt für Allgemeinmedizin“ gibt, kennt Italien diese Spezialisierung nicht. „Es ist hier einfach eine weiterführende Post-Laureat-Ausbildung. Vielleicht ist das auch ein Grund für das geringere Ansehen, das der Allgemeinmediziner hat – er ist ja nicht einmal ein Facharzt“, sagt Peter Grüner.
Hausarzt in Schnals
Vor knapp 40 Jahren begann Grüner als sogenannter „Hausarzt“ in Schnals. Damals gab es noch kein Handy und keinen PC in der Praxis. Die Versorgung der Patienten war deswegen aber nicht schlechter. Viele kamen in die Praxis, erinnert er sich, mit ihren Sorgen und Problemen und das waren nicht nur medizinische. „Damals hatte ich noch Zeit zuzuhören“, sagt er. Das hat sich mittlerweile geändert. Dabei haben die psychischen Probleme und Erkrankungen, die längere Gespräche und Behandlungen erforderten, in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen.
Unternehmen Hausarzt
Die Wenigsten wissen, dass der Arzt für Allgemeinmedizin, im Volksmund „Hausarzt“, ein sogenannter Freiberufler ist, der seine Tätigkeit im Rahmen einer vertraglichen Bindung mit dem Landesgesundheitsdienst ausübt. Er muss eine Praxis haben, die er auf eigene Kosten einrichtet, und die meisten Hausärzte stellen auch – auf eigene Kosten – eine Sprechstundenhilfe an. Er hat alle Rechte und Pflichten wie jeder andere Selbständige in Italien auch. Die administrative Arbeit einer Praxis, die Abrechnung, die Bürokratie und der Druck der Wirtschaftlichkeit belasten. Es verwundert daher nicht, dass sich junge Ärzte lange überlegen, bis sie sich für den Weg in die Selbständigkeit entscheiden. Will man aber die medizinische Versorgung in der Peripherie, auf dem Land erhalten, muss man den Hausärzten Erleichterungen anbieten, weiß Peter Grüner. „Jedem Hausarzt sollte eine Sprechstundenhilfe zur Verfügung gestellt werden, das würde vieles lösen“, meint er. „Wenn Aufgaben in den Praxen an nichtärztliches Personal delegiert werden könnten, dann hätte man wieder mehr Zeit für die Patienten.“ Eine Umfrage des Instituts für Allgemeinmedizin 2022 unter Medizinstudenten ging der Frage nach, welche Faktoren die Wahl des Hausarztberufes begünstigen oder behindern. Mehr Zusatzdiagnostik in den Hausarztpraxen (z. B. Ultraschall, EKG, Spirometrie) wurde dabei als wichtiger Vorschlag genannt. Gleich dahinter folgen als Maßnahmen der Ausbau von Gemeinschaftspraxen mit bereitgestelltem nicht-ärztlichem Personal, Bürokratieabbau für mehr Betreuungsqualität und ein Anstellungsverhältnis aller Ärzte in Ausbildung. Ähnliche Forderungen stehen auch im 10-Punkte-Programm für ein besseres Gesundheitssystem in Südtirol des Team K.
Arzt-Patient-Beziehung
„Patienten kommen zu uns, weil sie Sorgen, Schmerzen oder Ängste haben“, sagt Grüner. Sie wollen Hilfe und die müssen wir ihnen geben. Und das funktioniert nur über Einfühlungsvermögen und Vertrauen, das der Patient zum Arzt entwickeln kann. Die rasante Entwicklung, die die Medizin in den letzten fünfzig Jahren genommen hat, hat Folgen, die das Arzt-Patienten-Verhältnis erheblich erschweren. Zum einen haben sich Spezialisierungen und Hochspezialisierungen herausgebildet. Es ist heute schwer vorstellbar, dass ein Arzt alles weiß, jeder kennt sein Spezialgebiet, und das ist auch verständlich. Der Patient nimmt diese Zersplitterung wahr und hat den Eindruck, dass die Bedeutung des Menschen aus dem Blick geraten ist, dass also das Interesse der Medizin heute mehr auf die einzelnen Organe als auf den Menschen gerichtet ist. Die zweite große Veränderung sind die hervorragenden diagnostischen Instrumente, die der Medizin heute zur Verfügung stehen und die es uns ermöglichen, den Körper des Patienten bis ins kleinste Detail zu untersuchen. Aber mit ihnen ist auch die beruhigende Kraft der Hände durch den Arzt verschwunden, der die Menschen berührt hat. Der Medizinhistoriker Edward Shorter weist auf das Paradox hin, dass die Patienten sich weniger umsorgt fühlten, als die Medizin begann, sich mehr um sie zu kümmern. Bessere Behandlungen, eine größere Verfügbarkeit von Medikamenten und mehr auf Krankheiten ausgerichtete Therapiestrategien gingen einher mit einer Distanzierung der Ärzte vom Menschen. Es liegt auf der Hand, dass der Patient unter dieser abnehmenden Präsenz des Arztes leidet, was sich in einem Vertrauensverlust gegenüber dem Arzt und der Medizin niederschlägt.
Der Mensch ist keine Maschine
„Ich bin der Meinung, dass Allgemeinmediziner und Kinderärzte der Dreh- und Angelpunkt eines qualitativ hochwertigen Gesundheitssystems sein sollten“, sagt Peter Grüner. „Sie kennen ihre Patienten und begleiten sie nicht nur während einer Krankheitsepisode, sondern ein Leben lang. So entsteht ein Vertrauensverhältnis, und das ist es letztlich, was einen als Arzt erfüllt und was die Freude am Beruf ausmacht. Ein guter Hausarzt hat auch immer mit der Seele des Menschen zu tun. Er ist nicht nur Arzt, sondern auch Psychologe, Lebensberater und Seelsorger.
Schlechte Work-Life-Balance
Ein wesentlicher Punkt ist laut Grüner auch die Erreichbarkeit. Der persönliche Hausarzt muss jederzeit erreichbar sein, so sieht es auch das Gesetz vor. Grüners Handy war Tag und Nacht eingeschaltet. War er nicht im Dienst, war sein Vertreter erreichbar. Hausbesuche und Notfalldienst gehören zum weiteren Arbeitspensum. Das ist mit zunehmendem Alter sehr belastend. Eine Reduzierung des Arbeitspensums ab einem bestimmten Alter wäre sinnvoll, ist aber nicht vorgesehen. Nicht zuletzt könnte dies auch zur Burnout-Prophylaxe beitragen. Der Trend geht heute eindeutig in Richtung Gruppenpraxen. Die jungen Ärzte von heute wollen offensichtlich nicht mehr als Einzelkämpfer eine Praxis mit allen Zwängen und Risiken führen. In Gruppenpraxen soll ein Arzt rund um die Uhr erreichbar sein. Das funktioniere in Ballungszentren, meint Grüner, auf dem Land, wo eine Gruppenmedizin aus geographischen Gründen oft nicht realisierbar ist, brauche es andere Entlastungshilfen für den Hausarzt, wie z. B. die Förderung der Vernetzung von benachbarten Praxen, die Hilfe bei der Praxis- und Wohnungssuche …
Telemedizin und Digitalisierung
In Deutschland ist seit kurzem eine telefonische Krankmeldung bis zu fünf Tagen möglich. Diese Regelung wurde während der Coronapandemie eingeführt, um die Arztpraxen zu entlasten und die Infektionsgefahr zu verringern. Arbeitnehmer können sich telefonisch krankschreiben lassen. Arztpraxen dürfen telefonische Krankschreibungen jedoch nur für Patienten ausstellen, die ihnen bekannt sind. Leider ist diese Möglichkeit in Italien mit Auslaufen der Corona-Pandemie wieder abgeschafft worden und der Arbeitnehmer muss wieder – auch wegen eines banalen grippalen Infekts oder einer ihm schon lange bekannten Migräne – die Arbeitsunfähigkeit persönlich im Ambulatorium abholen. Die ambulante Versorgung wird deutlich digitaler werden, sagen viele Experten. Die Videosprechstunde kann entlasten, bestätigt auch Grüner, aber älteren Menschen mit mehr Krankheiten hilft sie kaum. Der persönliche Kontakt des behandelnden Arztes zu seinen Patienten bleibe für eine verlässliche Diagnose in der Regel unverzichtbar. Telemedizin könne das persönliche Gespräch und das daraus resultierende Vertrauensverhältnis nicht ersetzen, sondern allenfalls ergänzen. Große Hoffnungen setzt man bei uns nun auf die so genannte elektronische Gesundheitsakte (EGA), die ab September kommen soll. Dort können dann alle medizinischen Dokumente wie Labor- oder Röntgenbefunde, Krankenhausentlassungsbriefe oder digitalisierte Rezepte für Facharztleistungen und Medikamente abgerufen werden. Das Hochladen der Dokumente erfolgt automatisch. Auch die freie Wahl des Haus- oder Kinderarztes ist über die EGA möglich. Nur mit Zustimmung des Patienten stehen die Informationen auch dem medizinischen Fachpersonal zur Verfügung. Die Vernetzung zwischen Spitälern, Fachärzten und Hausärzten erleichtert vieles, ist auch Grüner überzeugt. Die Vorteile der Datenvernetzung überwiegen die derzeit noch bestehenden Nachteile – siehe Datensicherheit – bei weitem. Die Haus- und Kinderärzte im Pustertal sowie im Wipp- und Eisacktal fürchten aber um ihr seit über 13 Jahren bestens funktionierendes Patienteninformationssystem IKIS, das durch die Elektronische Gesundheitsakte EGA ersetzt werden soll.
Vernetzung
„Im Gegensatz zu IKIS stehen die Dokumente in der EGA den Haus- und Kinderärzten nur als PDF mit minimalen Zusatzinformationen und fehlender Strukturierung zur Verfügung. Die Suche nach Befunden, die erst ab 2020 und zudem nur unvollständig vorliegen, ist dadurch deutlich zeitaufwändiger. In IKIS können Befunde mit wenigen Klicks gefunden werden, ein Trend für einen Wert kann einfach grafisch dargestellt werden. Diese Informationen sind für die Diagnosestellung und Therapieentscheidung wichtig“, sagt die Allgemeinmedizinerin Astrid Marsoner im Interview mit „stol“. Das Zweite ist die Einführung des neuen landesweiten Informationssystems „NGH – New Generation Hospital Information System“ anstelle von IKIS in allen Spitälern. Das neue System sei noch nicht ausgereift und die Behebung von Systemfehlern oder Mängeln gehe derzeit nur schleppend voran, bedauert Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Was den hausärztlichen Nachwuchs betrifft, hofft Messner, dass der im Herbst startende Medizinstudiengang an der Claudiana in Kooperation mit der Universität Cattolica die Ausbildung für Allgemeinmedizin aufwerten wird. Fakt ist: Viele Allgemeinmediziner werden in den nächsten Jahren in Pension gehen! Fakt ist auch, dass eine gute wohnortnahe Versorgung der Patienten auch eine Entlastung der Krankenhäuser bedeutet.
Echte Unterstützung
Der Aufbau einer funktionierenden Vernetzung zwischen Hausärzten, Apotheken und Krankenhäusern mit einer einheitlichen IT-Lösung ist für Peter Grüner eine der zentralen gesundheitspolitischen Aufgaben der kommenden Jahre. Auch die Ausstattung der Praxen mit diagnostischen Geräten wie Minilabor und EKG sollte Standard werden. Die rechtzeitige Schulung der Ärzte im Umgang mit Künstlicher Intelligenz wird die tägliche Arbeit erleichtern. Gemeinschaftspraxen in Städten und größeren Gemeinden sollten gefördert und die Einstellung von Sprechstundenhilfen und Krankenpflegern besser unterstützt werden. Wo eine Gemeinschaftspraxis nicht möglich ist (wie z. B. in entlegenen Tälern) sollte die Vernetzung benachbarter Praxen gefördert werden. Die Gemeinden sollten angehenden Hausärzten bei der Suche nach einer geeigneten Praxis behilflich sein. „Der Hausarzt ist das Rückgrat des Gesundheitswesens. Er ist für alle da. Und er schaut nicht nur auf das Symptom, sondern hat den ganzen Menschen im Blick“, sagt Peter Grüner. Was er sich wünscht: flexiblere Arbeitsmodelle, vor allem für Hausärzte im fortgeschrittenen Alter und Frauen, die Familienleben und Beruf unter einen Hut bringen müssen (2/3 der Medizinstudenten sind mittlerweile weiblich!), Entlastung von Bürokratie, zum Beispiel durch eine Krankenpflegerin, eine Sprechstundenhilfe in der Praxis, eine gute Vernetzung durch ein funktionierendes IT-System. Sorge bereitet ihm, dass immer mehr private Gesundheitseinrichtungen die Versorgung der Patienten, die es sich leisten können, übernehmen und die Menschen immer mehr das Vertrauen in das öffentliche Gesundheitssystem verlieren. „Die Gefahr einer Kommerzialisierung der Medizin, einer Zwei-Klassen-Medizin, ist groß“, so Grüner abschließend. Die Menschen haben aber ein Recht auf ein öffentliches Gesundheitssystem, auf das sie sich verlassen und dem sie vertrauen können.
Zusammenfassung
Es ist die zentrale Aufgabe der verantwortlichen Politik, unser öffentliches Gesundheitssystem nicht nur sozial, sondern auch nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten. Dazu gehört insbesondere, die Rolle der Hausärzte in der primären medizinischen Versorgung, der Prävention und der Nachsorge weiter zu stärken. Hausärzte sind oft die erste Anlaufstelle für Patienten und spielen eine entscheidende Rolle bei der frühzeitigen Erkennung und Behandlung von Krankheiten. Doch es bedarf nicht nur einer Stärkung ihrer Rolle, sondern auch der Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen, um den Beruf des Hausarztes wieder attraktiver zu machen. Dies beinhaltet angemessene Vergütung, weniger bürokratische Hürden und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Motivierte Ärzte, die mit Leidenschaft und Hingabe für das Wohl ihrer Patienten arbeiten, sind das Rückgrat eines funktionierenden Gesundheitssystems. Darüber hinaus müssen öffentliche Einrichtungen, wie Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen, so ausgestattet und organisiert werden, dass sie den steigenden Anforderungen einer alternden Gesellschaft gerecht werden können. Das bedeutet, dass Investitionen in moderne Infrastruktur, digitale Gesundheitslösungen und eine ausreichende personelle Besetzung notwendig sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass jeder Bürger unabhängig von seinem sozialen Status Zugang zu einer hochwertigen medizinischen Versorgung hat. Um eine Zwei-Klassenmedizin zu verhindern, ist es entscheidend, dass die Qualität und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung für alle Bürger gewährleistet bleibt. Die Auslagerung von medizinischen Dienstleistungen an private Einrichtungen mag in manchen Fällen eine kurzfristige Entlastung bieten, sollte jedoch nicht als dauerhafte Lösung angesehen werden. Wenn diese Praxis zur Norm wird, besteht die Gefahr, dass sich die Versorgungsschere weiter öffnet und der Zugang zu hochwertiger medizinischer Betreuung zunehmend von der finanziellen Situation des Einzelnen abhängt. Es ist daher von größter Bedeutung, nachhaltige und integrative Lösungen zu entwickeln, die allen Menschen unabhängig von ihrem sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund eine gleichwertige Gesundheitsversorgung bieten.
Es liegt an der Politik, wie sich das Gesundheitswesen entwickelt
Laut Berechnungen der Südtiroler Ärztekammer wird es in den kommenden zehn Jahren zu einem massiven Abgang der Hausärzte kommen, der mit dem Nachwuchs kaum auszugleichen ist. Unser Gesundheitssystem sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert.
Wie man die Grundsätze der medizinischen Versorgung von morgen gestalten sollte, darüber sprachen wir mit Eugen Sleiter, dem Tiroler Hausarzt und Sprecher der Allgemeinmediziner.
Herr Sleiter, wie geht es Ihnen als Hausarzt?
Eugen Sleiter: Ich bin seit über 20 Jahren in der Medizin tätig, davon seit mehr als 15 Jahren als Hausarzt. In den letzten 10 Jahren hat sich die Arbeit in der Hausarztpraxis erheblich verändert, und nach der Pandemie hat sich der Alltag nochmals deutlich beschleunigt.

Eugen Sleiter
Hausarzt zu werden, ist nicht mehr attraktiv. Stimmt das?
Ich finde, dass der Hausarztberuf nach wie vor attraktiv ist. Allerdings sollten die Rahmenbedingungen angepasst werden, um den Beruf für junge Kollegen wieder attraktiver zu machen und wettbewerbsfähig im Vergleich zum nahen Ausland zu bleiben. Es ist wichtig, zu zeigen, dass man als Hausarzt eine sehr vielseitige Tätigkeit ausüben kann. Dafür müssen jedoch die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden, damit man diese Aufgaben auch wirklich erfüllen kann.
Zu viele Patienten, zu wenig Ärzte und eine Ruhestandswelle naht. Zugleich steigt der Versorgungsbedarf, denn wir altern. Was müssen wir zuallererst tun, damit es nicht zum Niedergang des öffentlichen Gesundheitssystems kommt?
Zunächst müssen wir unsere Praxen in der Peripherie erhalten, weiter ausbauen und in den Städten durch Zusammenlegungen stärken. Es ist essenziell, auch in ländlichen Gebieten weiterhin einen Hausarzt als festen Ansprechpartner für die Patienten anbieten zu können. Jeder Hausarzt sollte zudem mit einer Praxismitarbeiterin und einem Krankenpfleger unterstützt werden. Wenn wir das öffentliche Gesundheitssystem langfristig aufrechterhalten und die Peripherie stärken wollen – und wir wissen seit über zehn Jahren, was auf uns zukommt – müssen wir sicherstellen, dass Hausärzte als erste Ansprechpartner bestens aufgestellt sind, um ihre Arbeit so gut wie möglich zu leisten und das Krankenhaus zu entlasten.
Man hört immer wieder, dass der Beruf des Allgemeinmediziners unattraktiv sei. Zurecht?
Ich kann Ihnen darauf vielleicht wie folgt antworten: Derzeit haben wir einen Studenten im letzten Studienjahr, der sein Klinisch-Praktisches Jahr bei uns absolviert und seit vier Wochen in unserer Praxis tätig ist. Er kommt aus Meran, studiert in Innsbruck und ist von unserer Praxis begeistert. Täglich erkennt er die Vielzahl an Möglichkeiten, die wir haben, um sowohl chronischen als auch akuten Patienten zu helfen. Sei es durch EKGs, Spirometrien, Ultraschalluntersuchungen, die Erstversorgung von Wunden, kleine operative Eingriffe oder Infusionen – er hat die Vielseitigkeit dieses Berufs erst jetzt richtig wahrgenommen. Das hat sein Interesse geweckt, selbst eine Ausbildung zum Hausarzt zu absolvieren. Wenn wir junge Kollegen an uns binden oder für den Beruf begeistern möchten, müssen wir in sie investieren. Es ist wichtig, ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten, um sie trotz möglicherweise höherer Gehälter im nahen Ausland für uns zu gewinnen. Das könnten wir durch Startbudgets, die Mitfinanzierung von Geräten oder die Übernahme der Kosten für Praxismitarbeiter erreichen. Auf diese Weise können wir den Beruf für junge Mediziner attraktiv gestalten
Was erwarten Sie sich diesbezüglich vom Südtiroler Medizinstudiengang an der Claudiana, die im Herbst startet?
Aus klinischer Sicht sehe ich ehrlich gesagt nicht viele Vorteile in der Gründung einer Medizin-Universität in Bozen, da wir uns hier mehrere Probleme selbst schaffen. Um eine qualitativ hochwertige medizinische Ausbildung anzubieten, benötigt man eine ausreichende Fallzahl. Diese ist in Innsbruck gegeben, wo die Bevölkerung aus Nordtirol, Südtirol und Osttirol zusammenkommt. Eine zukünftige Medizin-Universität in Bozen, die nur eine kleine Zahl an Südtiroler Studenten aufnehmen würde, bringt sehr hohe Anschaffungskosten und laufende Betriebskosten mit sich, und ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber. Hinzu kommt, dass die Ärzte in unseren Krankenhäusern bereits jetzt stark ausgelastet sind und zusätzliche Medizinstudenten betreuen müssten. Wenn man bedenkt, wie viele Millionen Euro in dieses Projekt investiert werden sollen, nur aus politischer Motivation heraus, könnte man diese 16 zukünftigen Medizinstudenten aus Südtirol, die einen Platz in Bozen ergattert haben, auch anders fördern. Es gibt zahlreiche Universitäten im nahen Ausland, aber auch in Italien, an denen Südtiroler ihr Medizinstudium absolvieren können. Ich persönlich würde vorschlagen, dass wir zunächst alle Medizinstudenten durch Stipendien und Förderungen unterstützen. Das wäre deutlich kostengünstiger als die Gründung und der Betrieb der Uni Cattolica in der Claudiana und würde eine erste positive Bindung mit den angehenden Ärzten schaffen. Ein Beispiel aus der Praxis: Der junge Kollege aus Meran, der derzeit bei mir sein Praktikum absolviert, wurde bereits im fünften Studienjahr von der Schweiz abgeworben und wird dort seine Spezialisierung machen. Solche Abwerbungen könnten wir verhindern, indem wir frühzeitig in die Förderung unserer Medizinstudenten investieren.
Es heißt, wir hinkten in Bezug auf die Digitalisierung nach. Warum ist diese so wichtig?
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen spielt eine entscheidende Rolle, um reibungslose Abläufe und eine nahtlose Kommunikation zwischen Krankenhäusern, Fachärzten, Hausärzten und anderen medizinischen Einrichtungen zu gewährleisten. Eine einheitliche digitale Infrastruktur kann nicht nur den Informationsfluss beschleunigen, sondern auch die Patientensicherheit erheblich erhöhen. Ein Beispiel hierfür ist die Vermeidung unnötiger Doppeluntersuchungen, die auftreten können, wenn wichtige Informationen über durchgeführte Untersuchungen nicht rechtzeitig an alle beteiligten Ärzte weitergeleitet werden. Dies kann zum Beispiel zu unnötiger Strahlenbelastung und potenziellen klinischen Risiken führen bei wiederholten CT`s oder Röntgenaufnahmen.
Wie denken Sie in diesem Zusammenhang über die Einheitliche Gesundheitsakte (EGA)?
Die Einführung einer einheitlichen Elektronischen Gesundheitsakte (EGA) wäre ein entscheidender Schritt, um Gesundheitsdaten auf europäischer Ebene zusammenzuführen und den Austausch zwischen verschiedenen Gesundheitssystemen zu erleichtern. Während einige Regionen wie Trient bereits seit über zwölf Jahren von einer funktionierenden digitalen Infrastruktur profitieren, steckt die EGA in Südtirol leider noch in den Kinderschuhen. Viele Hausärzte und Fachärzte sehen sich mit dem Problem konfrontiert, dass die EGA in ihrem derzeitigen Zustand aufgrund der langsamen Datenabrufgeschwindigkeit und unvollständigen Inhalte kaum praktikabel ist. Statt Zeit zu sparen, verlieren sie wertvolle Minuten, um im „Heuhaufen“ der EGA die sprichwörtliche Nadel zu finden.

Hausärzte werden wieder mehr
Erstversorgung übernehmen
Haben die Patienten nicht auch zu hohe Ansprüche und zugleich zu wenig Vertrauen in die ambulante Versorgung?
In einer Zeit, in der die Ansprüche der Patienten stetig wachsen, scheint es fast so, als ob jeder Mensch das Ziel hat, „gesund zu sterben“. Die Gesellschaft vermittelt uns ein Idealbild eines gesunden Lebensstils – geprägt von Sport, gesunder Ernährung, ohne Rauchen und Alkohol. Doch sobald mit etwa 50 Jahren die ersten gesundheitlichen Probleme auftreten, erwarten die Patienten schnelle, umfassende Diagnosen und die bestmögliche Behandlung. Es entsteht der Eindruck, dass die Patienten nicht etwa wenig Vertrauen in die ambulante Versorgung haben, sondern vielmehr auf die absolut beste Versorgung bestehen, die der öffentliche Dienst nicht immer zeitgerecht anbieten kann, da die Anfragen und Ansprüche alle Jahre wachsen.
Kann der Beruf des Hausarztes mit einer Festanstellung im Krankenhaus oder in einer privaten Einrichtung auch in Bezug auf Work-Life-Balance überhaupt konkurrieren?
Der Beruf des Hausarztes ist in seiner jetzigen vertraglichen Form durchaus konkurrenzfähig und könnte es auch bleiben, wenn die langen aufgeschobenen Probleme endlich angegangen und gelöst würden. Ein bezeichnendes Beispiel ist die Tatsache, dass der neue Gesundheitsassessor, Dr. Messner, und der Ressortdirektor, Michael Mayer, bis heute keine Zeit gefunden haben, sich mit den Gewerkschaften der Hausärzte zu einem Gespräch zu treffen und sich auszutauschen. Dies wirft natürlich Fragen auf und spricht Bände.
Entlastung von der Bürokratie, lautet eine weitere Forderung der Hausärzte. Was ist konkret damit gemeint?
Die zunehmende Digitalisierung und der Übergang zu weniger analogen Prozessen sollten eigentlich zu einer Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung in ganz Südtirol führen und Bürokratie abbauen. Dennoch sehen wir immer noch erhebliche Unterschiede in den Vorgehensweisen von Sprengel zu Sprengel, trotz der Existenz eines einheitlichen Sanitätsbetriebs. Hinzu kommen die wachsenden Anforderungen in Bezug auf Datenschutzrichtlinien und zusätzliche Bürokratie, die oft auf spezifische Anforderungen von Abteilungsdirektoren, Primaren oder Privatkliniken zurückzuführen sind. In unserer Praxis nehmen administrative Aufgaben wie das Umschreiben von Verordnungen der Privatkliniken mittlerweile 20-30 Prozent des Alltags in Anspruch, sodass man sich manchmal mehr als „SABES-Sekretär“ denn als Arzt fühlt.
Blicken wir in die Zukunft: Wie werden Hausärzte bei uns arbeiten, wie wird ihr Arbeitsplatz aussehen?
Diese Frage kann eigentlich nur von der Politik beantwortet werden. Mein derzeitiger Gesundheitsassessor, Dr. Messner, ist der fünfte, den ich in meiner Laufbahn erlebe, und bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es in den letzten Jahrzehnten keine einzige nennenswerte Verbesserung. Aber wie es meiner Einstellung entspricht: Die Hoffnung stirbt zuletzt, und ich lasse mich gerne überraschen, was in naher und ferner Zukunft auf uns zukommen wird.